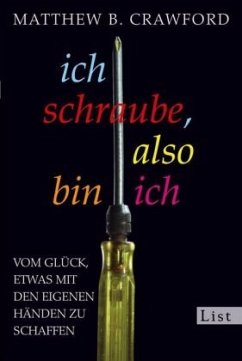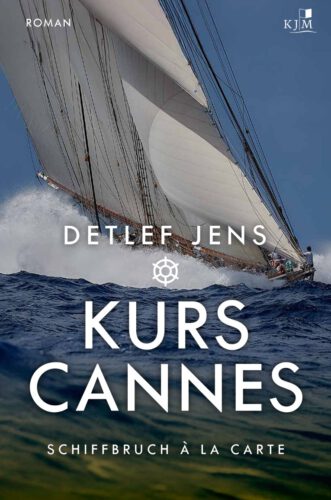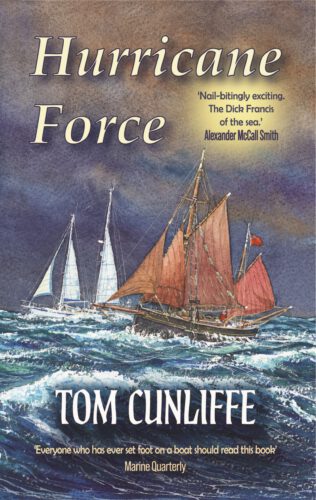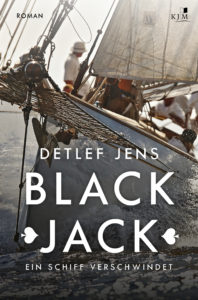Was haben Motorradschrauber mit Fahrtenseglern gemein? Vor etlichen Jahren bin ich schon einmal auf dieses Thema gestoßen, im Zusammenhang mit unterwegs improvisierten Reparaturarbeiten an Bord einer Langfahrtyacht wurde auf das Buch „Zen and the Art of Motorcyle Maintenance“ (Deutsch: „Zen und die Kunst, ein Motorrad zu warten“) von Robert M. Pirsig, mittlerweile ein Klassiker, hingewiesen.
Dann kam das Buch „Ich schraube, also bin ich“ von Matthew Crawford, Kulturforschender an der Universität von Virginia, und jetzt (bisher leider noch nicht auf Deutsch) das jüngst von der englischen Zeitung „Guardian“ zum Buch der Woche erklärte „Why We Drive“. Darin geht es um Menschen, die gerne Autofahren, die also im buchstäblichen Sinne das Steuer selbst in der Hand haben wollen. Weiter gefasst geht es natürlich auch darum, überhaupt im eigenen Leben nicht nur die Kontrolle zu behalten, sondern auch darum, sich nicht jede Tätigkeit von einer „smarten“ oder angeblich „intelligenten“ Maschine abnehmen zu lassen. Zugunsten von – ja, was eigentlich?
Tim Adams, Autor der ebenfalls englischen Tageszeitung „Observer“, hat die Rezension zum Buch geschrieben und steigt darin mit einer kleinen Szene ein: Er sitzt mit einer Gruppe von Google-Größen zusammen, die allesamt die Vorteile des neuen, selbstfahrenden Autos in den höchsten Tönen loben. Dies sei die Revolution im Straßenverkehr, sicherer, effizienter, kurz: „smarter“. Fahrer würden zu Passagieren und hätten mehr Zeit, sich mit anderen, weniger stressigen Dingen zu beschäftigen. Womit die Google-Größen sicher meinten: Mehr Zeit, um auf ihre Smartphones zu starren.
Als Tim Adams in dieser Runde die Frage stellte, ob man nicht unterschätze, wie viele Menschen eigentlich sehr gerne selber fahren, wurde das mit ehrlichem Unverständnis quittiert. Denn hier saßen Individuen beisammen, die mit dem Glauben und der Überzeugung unglaublich reich geworden sind, dass die Menschen, wie sie selbst, nur davon träumten, immer effektivere Tech-Lösungen für ihr Leben zu bekommen. Und immer mehr Zeit, sich mit ihren Smartphones zu beschäftigen.
Crawford, nachzulesen in seinem neuen Buch, ist da ganz anderer Meinung. Er stellt fest, dass „Technokraten und Optimierer alles Idiotensicher machen wollen, und dass sie uns in diesem Prozess wie Idioten behandeln. Und dass dies eine Art selbsterfüllende Prophezeiung ist, denn tatsächlich kommen wir uns ja immer dümmer vor. Vor diesem Hintergrund ist zu fahren nichts weniger, als unsere Fähigkeit, frei zu sein, auszuüben.“ Und er fügt hinzu: „Ich vermute, dass wir es deswegen so lieben, zu fahren.“ Und ich vermute, dass wir es deswegen umso mehr lieben, zu segeln.
Das Buch ist dabei keinesfalls ein Manifest von Menschen, die Benzin statt Blut in den Adern haben. Es geht vielmehr darum, die beängstigende Drift unserer Welt zu erfassen, mit dem tendenziell zunehmenden Verlust individuellen Agierens und ebenso dem Verlust der menschlichen Freude an erlernten Fähigkeiten und am kalkulierten Risiko.
Natürlich weiß auch Crawford, dass es umweltbezogene Gründe gegen die bedingungslose Liebe zum Verbrennungsmotor gibt. Darum geht es aber auch nicht. Sein Buch, das attestiert jedenfalls der Rezensent Tim Adams, sei ein starkes (und lesenswertes) Korrektiv gegenüber der Weisheit, dass der unbeschränkte Durchmarsch von allumfassenden Tech-Monopolen, die, gefräßig nach immer mehr Daten und dabei Aufmerksamkeit gegen Ablenkung eintauschend, angeblich so wichtig für den menschlichen Fortschritt sei. Und während diese Reise immer schneller vonstatten geht, wären wir sehr gut beraten, viel genauer darauf zu achten wo sie eigentlich wirklich hin geht.
Zum Abschluss und als Kontrapunkt ein schönes Zitat von Sir Robin Knox-Johnston. Seine Antwort auf die Frage, was das Segeln ihm bedeute: „Es geht um Freiheit. Auf dem Boot, an Bord, bin ich der Boss. Ich entscheide, wohin ich segele. Nur mit dem Wind. Ich beschäftige mich mit der Natur. Das kann zuweilen hart sein, aber es ist ehrlich. Und sehr befriedigend!“