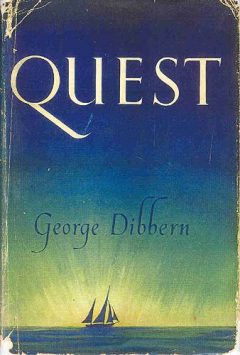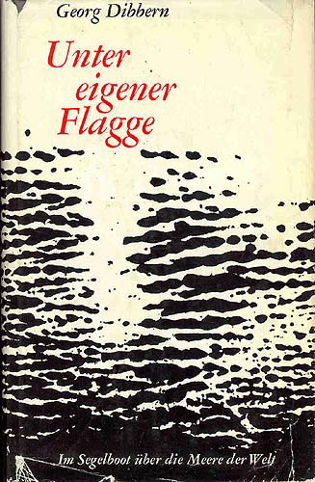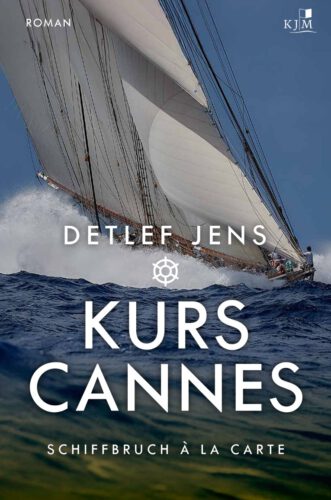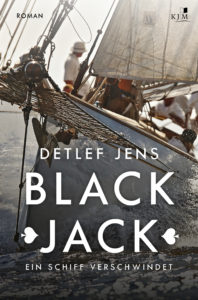Hier handelt es sich um ein faszinierendes Segelbuch, welches, wie alle guten Segelbücher, sehr viel mehr als nur ein solches ist. Ursprünglich erschienen 1941 in den USA, natürlich in englischer Sprache, beschreibt es die Reise eines Deutschen, der in Deutschland nicht heimisch war und der sich später als Weltbürger verstand und sich sogar einen eigenen Pass und eine eigene Flagge zulegte. In den Jahren von 1930 bis 1935 segelte Georg Dibbern mit Freunden von Kiel nach Neuseeland, mit einigen Umwegen durch das westliche Mittelmeer und nach San Francisco und Hawaii. Diese Reise an sich, in einem knapp 10 Meter langen Spitzgatter ohne Motor, ist an sich schon bemerkenswert genug. Das Buch aber geht tiefer und beschreibt auch die spirituelle Lebensreise des Verfassers, Georg Dibbern, eines wahrhaft ungewöhnlichen Menschen. Ein Abenteurer, ein Freigeist, selbsternannter Weltbürger und Freund aller Völker, Bord-Philosoph und Lebemann, von vielen Menschen damals und heute durchaus kontrovers betrachtet. Kurz, das sei hier vorweggenommen: Eine faszinierende Lektüre.
Dieses Buch fiel kurz nach Erscheinen dem amerikanischen Schriftsteller Henry Miller in die Hände, der es offenbar begeistert las. Auf jeden Fall schrieb er danach an Dibbern, es entstand eine lebenslange Brieffreundschaft zwischen den beiden, die sich als „Brüder im Geiste” verstanden. Persönlich getroffen haben sie sich nie, aber Miller, damals ein erfolgreicher und berühmter Schriftsteller, unterstützte nicht nur den ewig klammen Georg, sondern vor allem auch dessen in Deutschland lebende Frau und ihre drei Töchter durch Spenden und Spendenaufrufe. 1946 stelle Miller das Buch außerdem in den USA vor und verhalf ihm so zu einer gewissen Bekanntheit.
Aus der Rezension von Henry Miller (zur Verfügung gestellt von Dibbern-Verlegerin und Biografin Erika Grundmann): „Was würdest du tun, wenn ich tot wäre? Dies ist die Frage, die der Autor der Mutter seiner Kinder stellt. Es ist 1930 in Deutschland, mit mehr als sechs Millionen Arbeitslosen. George Dibbern ist ein Mann von 41 Jahren, der bereits einige wunderbare Jahre seiner Jugend mit den Maoris in Neuseeland verbracht hat. Nun lebt er von Arbeitslosenhilfe, und seine sämtlichen Wertgegenstände sind entweder verkauft oder verpfändet. Alle – außer des knapp 10 Meter langen Segelbootes, welches er auf den Namen Te Rapunga getauft hatte: „Die dunkle Sonne“ in der Sprache der Maori. In Deutschland gibt es für ihn keine Zukunft; er ist zu individuell, um ein guter Kommunist zu sein, und zu friedfertig, um zu einem Nazi zu werden. Er hat das alles mit sich ausgemacht und sich entschieden, nicht zu einem lebendigen Toten zu werden. Er wird sein Boot nehmen und nach Neuseeland segeln, wo „Mutter Rangi“, eine Maori Frau, die seine spirituelle Mutter ist, auf ihn warten wird.“
Soweit der erste Absatz von Millers Buchvorstellung aus dem Jahre 1946. Ausbrechen oder sterben! Nichts weniger als das war die Frage, die sich Dibbern stellte. Dass er seine Frau und Töchter in Deutschland zurückließ, obwohl er sie liebte, wirft immer wieder die gleichen Fragen auf: War er ein Idealist oder Egoist? Abenteurer und Seezigeuner oder Philosoph und Weltbürger? In dem Buch „Quest“ wird diese Frage eher am Rande behandelt, in der ausgiebigen und aufwändig recherchierten Biografie („The Dark Sun“) von Erika Grundmann sehr viel deutlicher beleuchtet.
Doch neben allen persönlichen und philosophischen Fragen, es ist schon die Beschreibung der Segelreise an sich, die für heutige, moderne Segler:innen ganz unglaublich klingen mag. Ein kleines, motorloses Boot mit dürftiger Ausrüstung, natürlich ohne jeglichen modernen Hilfsmittel und per Hand mit viel Mut, Gottvertrauen und bald auch Erfahrung um die halbe Welt navigiert. Den Gebrauch des Sextanten lernte Dibbern selbst offenbar nie und überließ die Navigation damit seinem Neffen und Mitsegler Günther Schramm; einen Chronometer bekamen sie erst in Kalifornien geschenkt. Nach einer glücklichen Atlantiküberquerung segelten sie ohne Seekarten zwischen den Inseln der Antillen hindurch bis nach Jamaika, wo die Crew ihr kleines Boot ebenfalls mit Geschick und Glück in den Hafen von Kingston brachte.
Man mag zu alledem stehen, wie man will. Erstklassiger Lesestoff ist es auf jeden Fall, und er bietet dazu sehr viel Stoff zum Nachdenken, über die großen Fragen des Lebens ebenso wie über die etwas kleineren, über das Segeln und wie es sich seither verändert hat. Eine deutsche Übersetzung von „Quest“ erschien 1965 unter dem Titel „Unter eigener Flagge“ bei Classen in Hamburg. Die deutsche Ausgabe ist derzeit leider nur antiquarisch erhältlich, das englische Original wurde von Erika Grundmann neu aufgelegt und kann bei ihr bestellt werden.
Hier geht es zum Literaturboot-Artikel über Georg Dibbern »