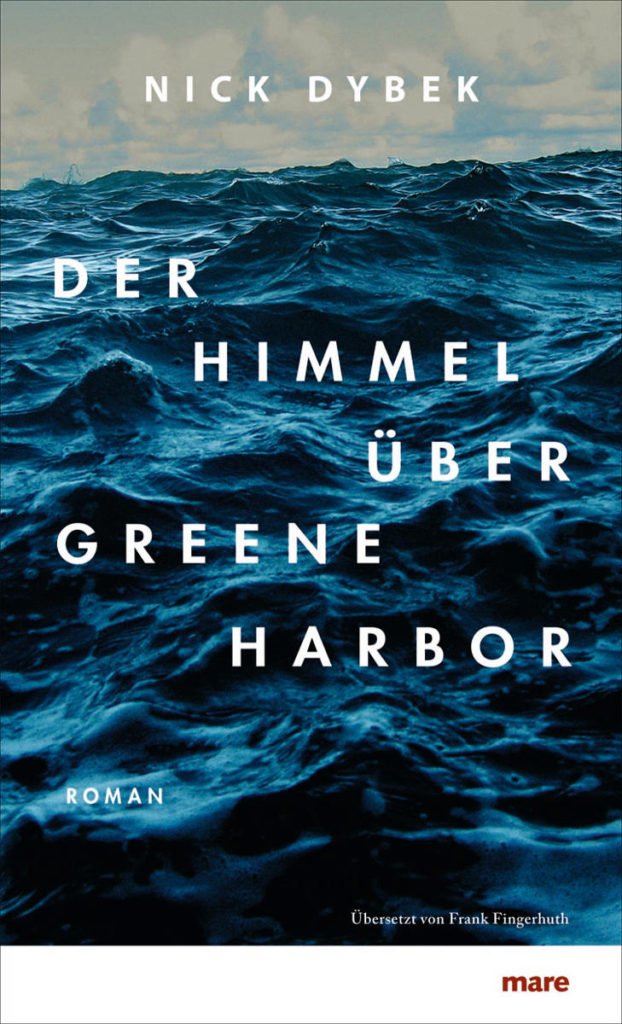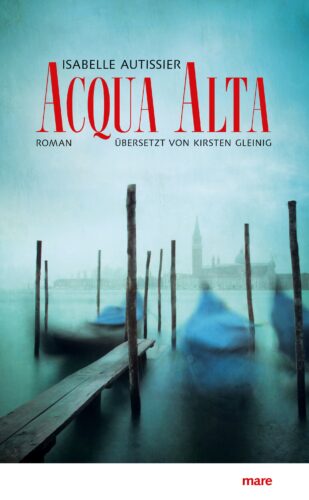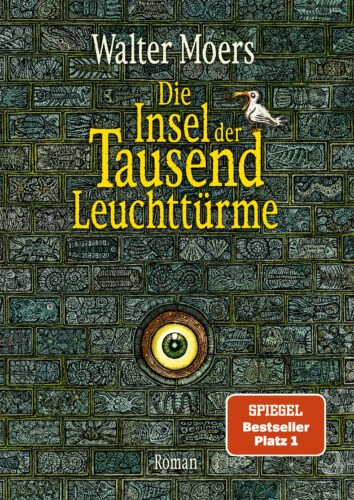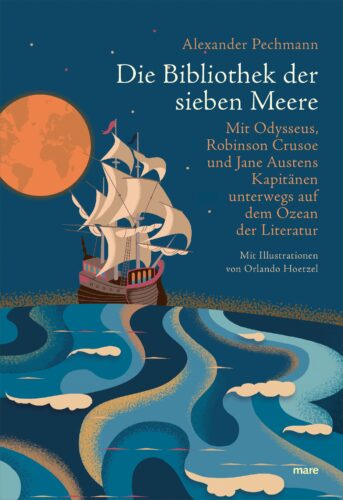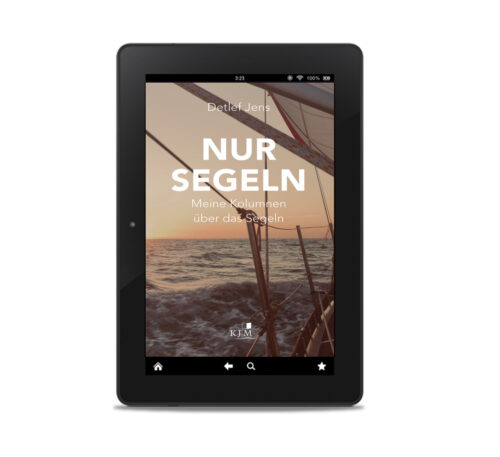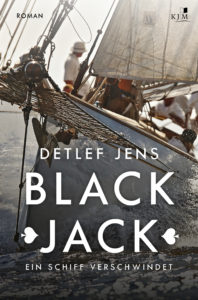Der in Amerikas Feuilletons gefeierte Debütroman von Nick Dybek (geboren 1980) liest sich anstandslos weg und zieht den Leser schnell in die Geschichte hinein: „Loyalty Island – das war der Gestank von Hering, Lackfarbe und fauligem Seetang an Anlegestellen und auf Stränden. Der Geruch von Kiefernnadeln, die sich am Boden braun verfärbten. Das Rumpeln von Außenbordern, von Windböen und Eismaschinen, das Heulen hydraulischer Winschen. Es war graues Dämmerlicht, das morgens und abends kam und ging – wie Ebbe und Flut.“ Will man nach diesen ersten Sätzen mehr wissen? Ja, komischerweise will man das. Es ist vielleicht auch diese sparsame und eher leidenschaftslose, dabei aber präzise Sprache, mit dem gelegentlichen Aufblitzen (schwarzen) Humors, das den Leser einfängt. Bemerkenswert auch, wie scheinbar authentisch die Landratte Dybek die Küste, die See, ja selbst das Leben an Bord der Fischereischiffe, das gelegentlich zum Vorschein kommt, beschreibt. Fesselnd aber ist die Vater – Sohn Geschichte – und zwar nicht nur eine, sondern zwei: die des „Helden“ (und Erzählers) Cal und seines Vaters und die des „Antihelden“ Richard und dessen Vaters – , dazu die Geschichte der beiden Freunde Cal und Jamie, wie sie sich erst finden und dann wieder verlieren und schließlich die Studie der Familie. Schmerzhaft ist es für alle Väter, werden sie doch irgendwann von ihren Söhnen entlarvt, durchschaut, entzaubert, vom Podest gestoßen. Ein 14-jähriger Junge also wird in diesem Buch erwachsen, oder zumindest wird er mit der Welt der Erwachsenen konfrontiert. In einer Situation, die am Ende ziemlich ausweglos erscheint und die daher von seinem Vater gelöst wird – auf eine Art und Weise, die vielleicht unausweichlich, aber auch nicht gerade angenehm ist, für keinen der Beteiligten.
Fragen tauchen unweigerlich auf beim Lesen. Warum mach Cal das, was er am Ende macht? Aus Loyalität zu seinem Vater zerstört er Freundschaften und Leben. Macht sich zum Komplizen. Aber Blut ist dicker als Wasser. Auch wenn seine Familie ansonsten auseinander fällt. Viele Fragen werden aufgeworfen, nicht alle beantwortet, aber zu letzterem ist Literatur, oder Kunst, ja auch gar nicht da. Nachdenklich machen, ja, das schon, und das gelingt hier, dieses Buch schwingt lange nach. Weil es eine kraftvolle Story ist, wie aus einem Drama von Shakespeare – was der Autor übrigens in einem Interview auch sagt: „Es war ein ganz bestimmtes Bild aus Shakespeares Historiendrama Richard II., das mir die Idee für den Roman eingegeben hat: Der entthronte König sitzt im Gefängnis, und während er sich den Kopf darüber zerbricht, wieso er dort gelandet ist, hört er von nebenan geheimnisvolle Musik.“
Als Kulisse wählte Dybek ein (fiktives) Fischerdorf im pazifischen Nordwesten. Vielleicht ist es auch einfach nur öde und trostlos, dort zu leben, abhängig vom Fischfang und ohne jede andere Perspektive? Aber das ist ja auch gar nicht das Thema. Oder doch? Väter, die ein halbes Jahr auf See sind werden von ihren Söhnen auch deswegen verklärt, mehr natürlich als Väter, die jeden Abend genervt und müde von der Arbeit nach Hause kommen. Dazu die desillusionierten Mütter. Diese Tristesse macht schon beklommen. Vor allem, wo am Ende die Frage im Raum steht: Was soll das alles? Diese Leere, Sinnlosigkeit des Daseins. Nicht sehr schön. Dies ist denn auch meine Kritik an dem dennoch sehr lesenswerten und bewegenden Buch: Das Ganze hätte auch irgendwie eine Spur romantischer zugehen können… Und noch eins. Der Originaltitel (When Captain Flint Was Still a Good Man) trifft es auch irgendwie besser. Aber davon abgesehen: Wirklich empfehlenswert.